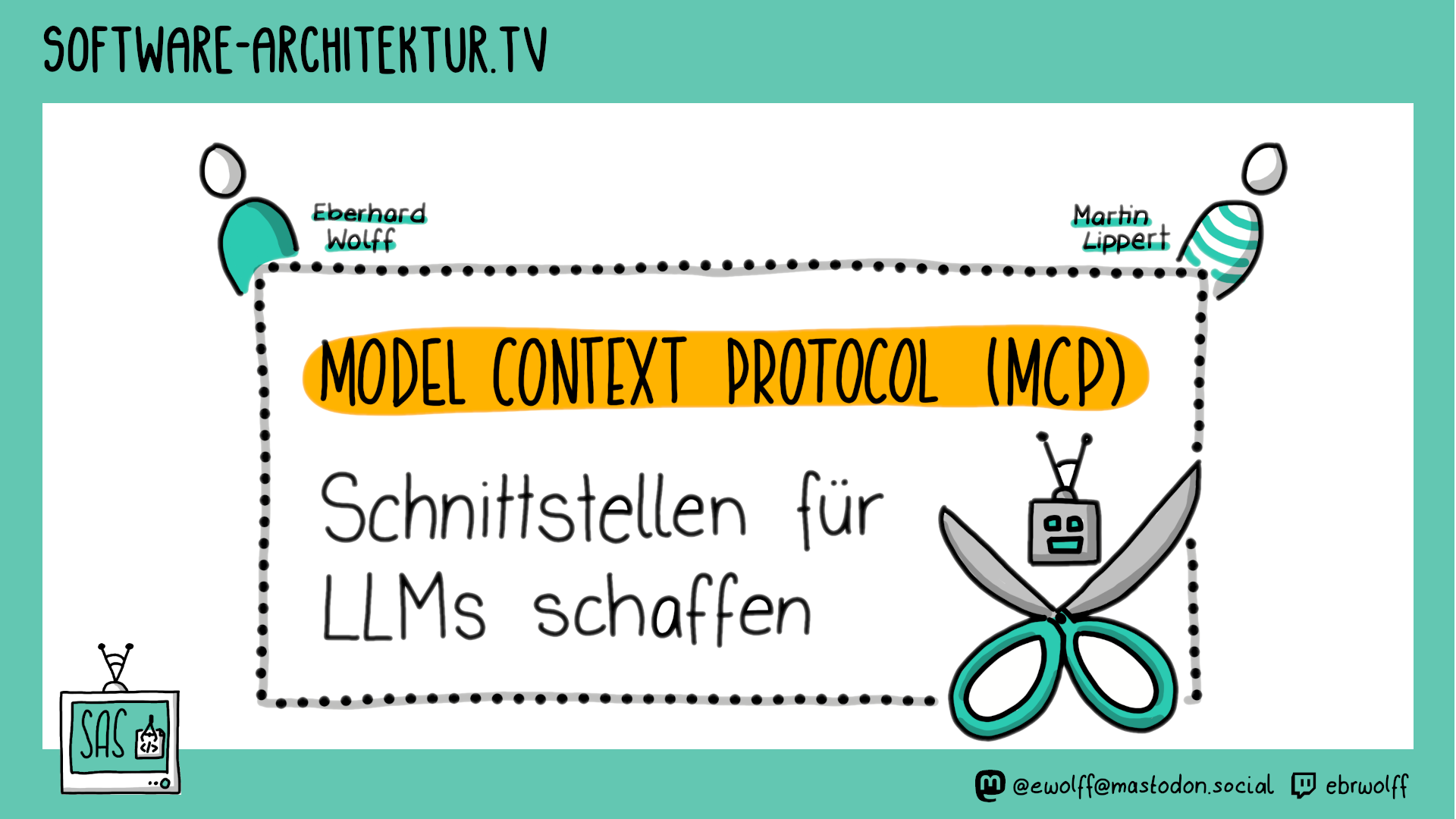Das Model Context Protocol (MCP) wird nicht ohne Grund als das USB-C für Large Language Models (LLMs) bezeichnet: Es schafft einen Standard, wie LLMs auf Kontextinformationen zugreifen und externe Werkzeuge steuern können. Das hat große Auswirkungen auf die Entwicklung von KI-Anwendungen. In diesem Stream schauen wir uns an, warum MCP gerade in aller Munde ist, wie es funktioniert, und was es für Entwickler:innen konkret bedeutet. Mit dabei eine Live-Demo mit Spring AI. Martin Lippert leitet die Entwicklung der Spring-Tools und kann auf langjährige Erfahrung als Entwickler und Speaker zurückblicken.
Links
- MCP Model Context Protocol
- Verzeichnis von Servern
- MCP Java SDK
- Spring AI MCP
- Spring AI Beispiel
- Craig Walls Spring AI Beispiele
- Open WebUI MCP-Unterstützung
- MCP-Spezifikation zu Autorisierung
- Blog zu OAuth und MCP
- Gandalf: Spiel zu Prompt-Injection
2025-08-01 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast