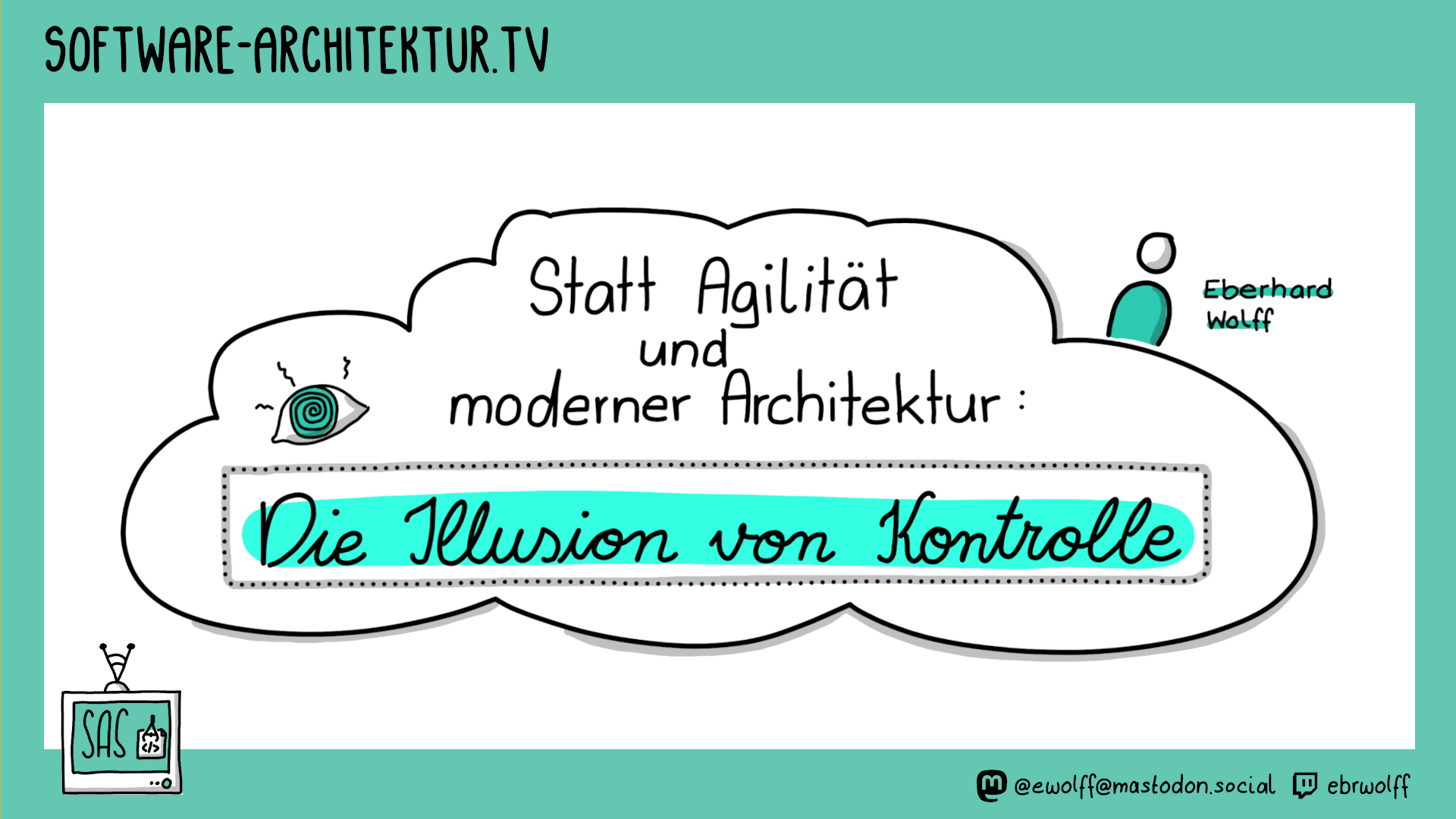Agile Entwicklung verspricht einen besseren Umgang mit Unsicherheit – und doch dominieren in vielen Projekten weiterhin detaillierte Pläne, Feinkonzepte und Architektur mit Big Design Up Front. Warum fällt es so schwer, loszulassen?
Diese Episode beleuchtet die psychologischen Gründe hinter dem Festhalten an Planung: das Bedürfnis nach Sicherheit, die Angst vor Chaos und die Illusion von Kontrolle. Und sie zeigt, welche Bedingungen nötig sind, damit Teams sich wirklich auf das Unplanbare einlassen können – mit Vertrauen, Mut und einer gesunden Fehlerkultur.
Links
- Are We Engineers? With Hillel Wayne
- Zukunftssichere Architekturen - Keine gute Idee?
- Prof. Christiane Floyd zu “menschenzentrierter Software-Entwicklung”
- Postagilität - Was kommt jetzt? mit Tanja Friedel und Uwe Vigenschow
- Software-Entwicklung = Lernen
- Intro to Beyond Estimates with Woody Zuill
- Gibt es das Wasserfallmodell überhaupt?
2025-05-23 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast