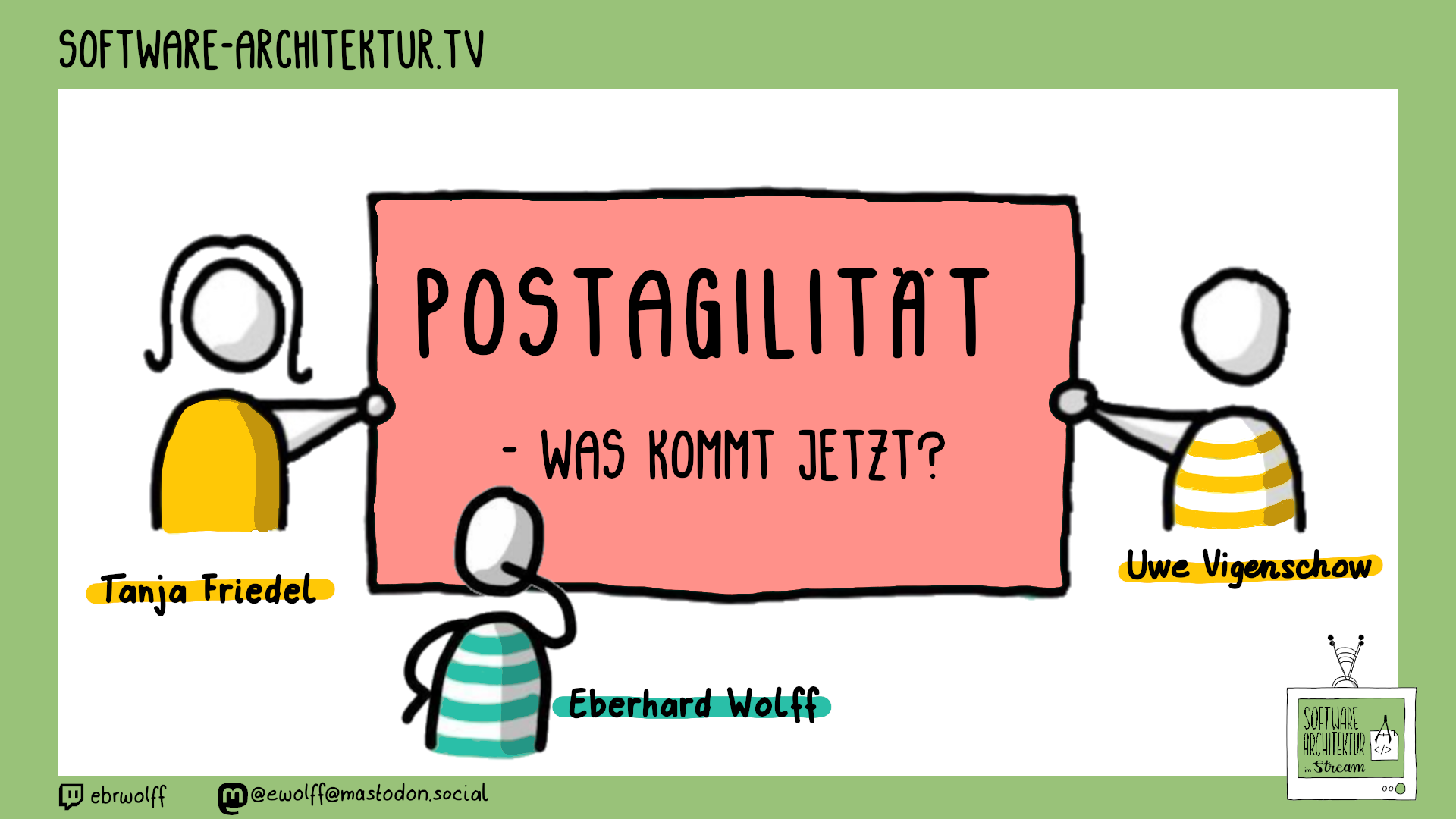Der Begriff „Agilität“ ist in den letzten 20 Jahren für alles Mögliche benutzt worden. Dadurch ist Agilität bedeutungsleer geworden. Andererseits ist es durch den Fokus auf Methoden entkoppelt vom Ziel, was wir über die Werkzeuge erreichen wollen. Das ist in den aktuellen Zeiten umso dramatischer, weil die Resilienz von Organisationen, also ihre Fähigkeit, sich einem dynamischen und komplexen Umfeld anzupassen, Krisen zu überstehen und gleichzeitig zu wachsen, eigentlich nur mit echter Agilität erreichbar ist.
Tanja Friedel und Uwe Vigenschow glauben, dass die Zukunft der Softwareentwicklung in einer Rückbesinnung auf die Werte und Prinzipien liegt, die hinter Agilität ursprünglich standen. Außerdem ist eine Fokussierung auf die Ergebnisse zentral - statt auf Hilfsmittel zur Zielerreichung wie Prozesse oder sinnentleertes Feel Good. Sie ziehen die Lehren aus über 20 Jahren Agilität und zeigen den Einfluss z.B. von KI und Homeoffice auf. Und sie berichten, wie sie Kunden dabei helfen, die Arbeitsweisen anzupassen, Anforderungen anders zu erheben und die Struktur der Software anzupassen.
Links
Tags: Agilität Postagilität2025-05-16 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast