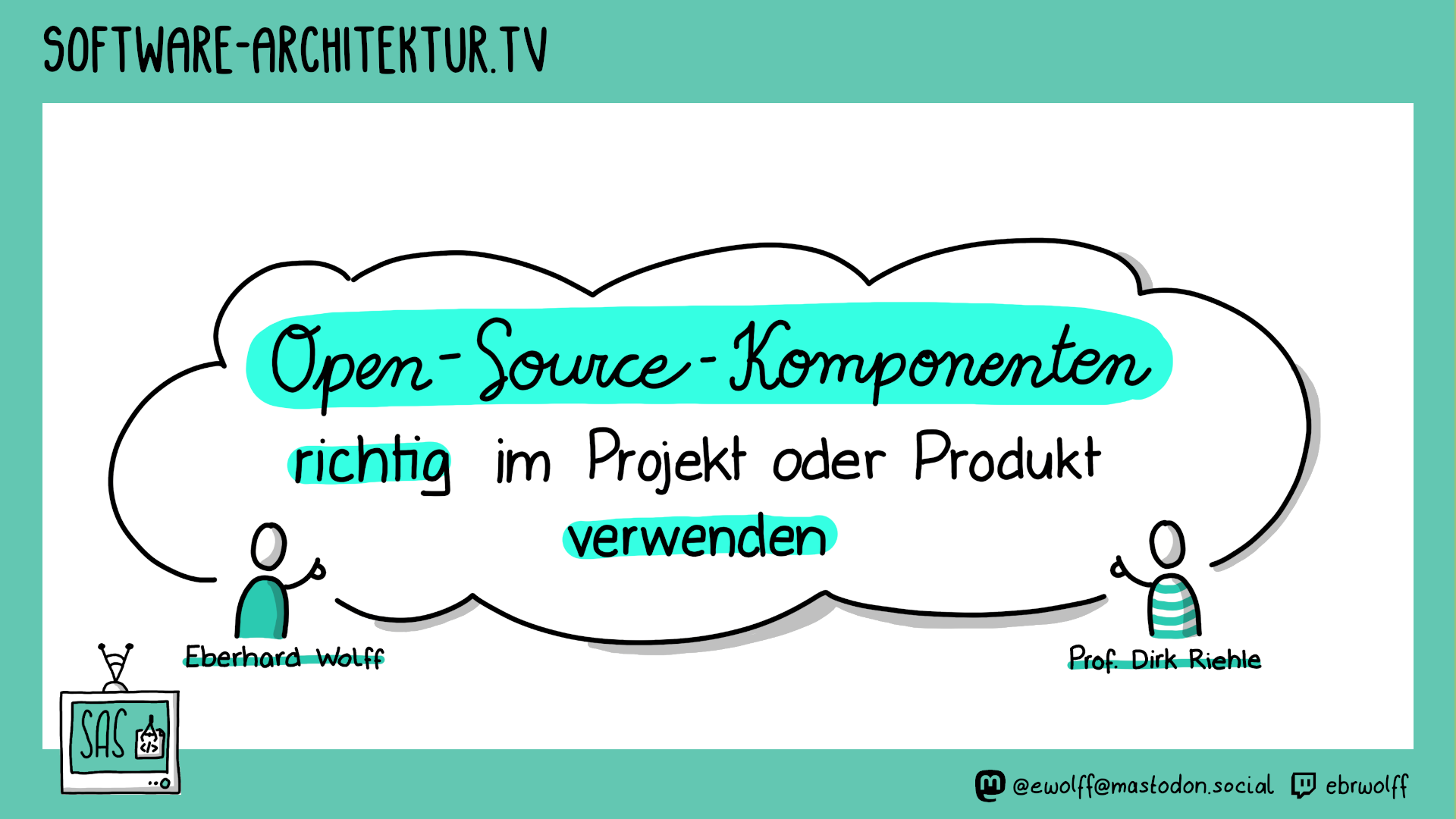Kaum ein Software-Projekt kommt heute noch ohne Open-Source-Teile aus. Wie kann man solche Komponenten im Projekt rechtlich und technisch richtig einsetzen? Welche Auswirkungen haben Lizenzen mit einem Copyleft? Was gilt es in Bezug auf Compliance zu beachten? Gerade der EU Cyber Resilience Act bringt das Thema wieder auf die Agenda. Prof. Dirk Riehle ist Professor für Open-Source-Software und diskutiert diese und andere Fragen mit uns.
Links
- Prof. Riehles Trainings
- Prof. Riehles Werkzeuge
- xkcd zu Open-Source-Abhängigkeiten
2025-07-04 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast