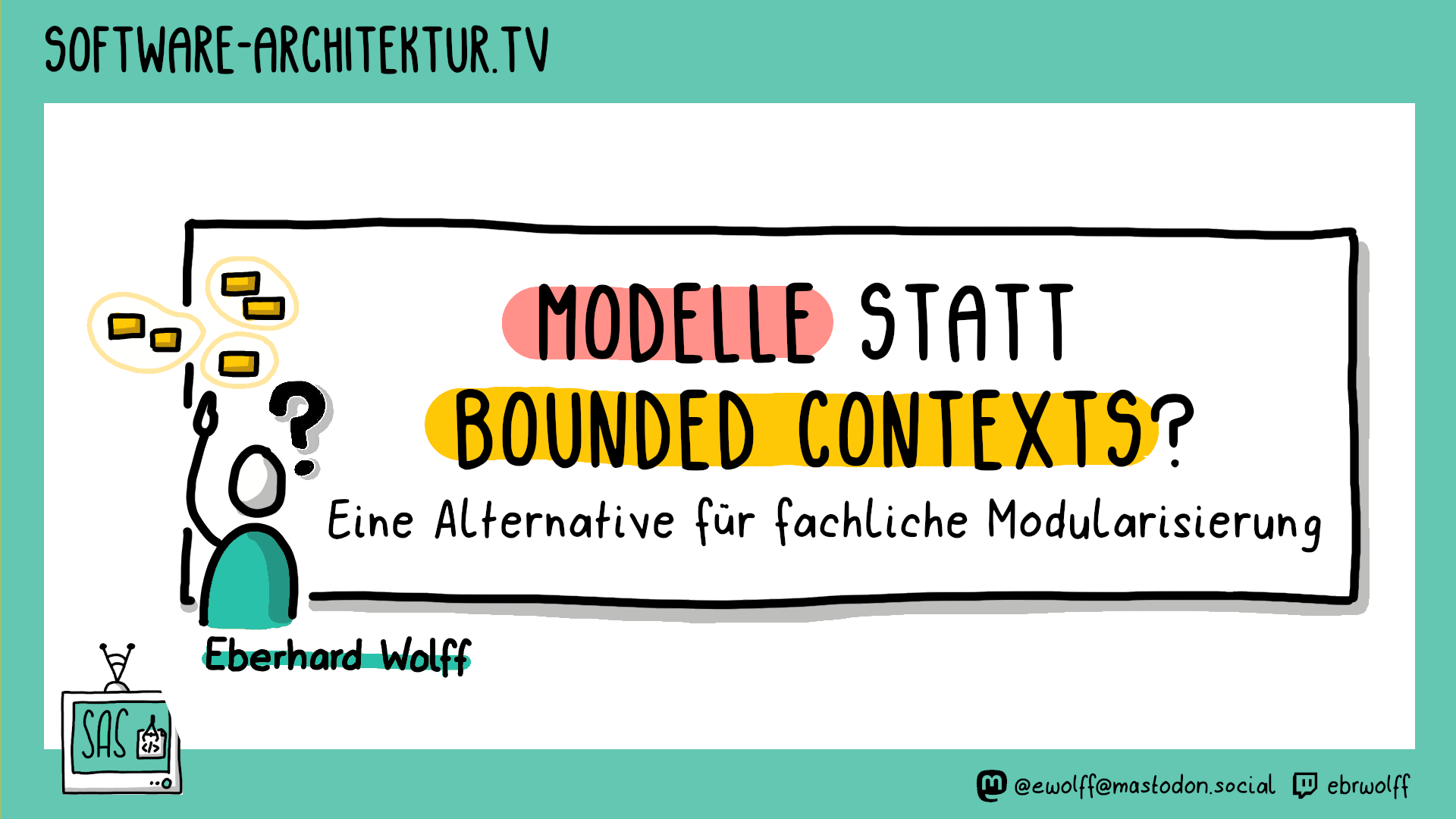Bounded Contexts werden oft als Allheilmittel für die fachliche Modularisierung von Software betrachtet – eine zentrale Herausforderung bei der Entwicklung wartbarer Systeme. Allerdings ist das Konzept des “Bounded Context” komplex und in der Praxis nicht immer einfach umzusetzen. In dieser Episode diskutieren wir “Modelle” als Ansatz zur Identifizierung fachlicher Module. Sie sind zwar ein Bestandteil von Bounded Contexts, können aber auch – kombiniert mit Ideen wie Modulen oder Abstract Data Types – eigenständig zur fachlichen Modularisierung eingesetzt werden.
Links
- Architektur Kickstart
- Bounded Context - Was ist das genau?
- Objektorientierung - Was ist das eigentlich?
- BlueSky Posting: TDD = Benutzungsperspektive von Jason Gorman
- Cell-based Architecture bei Wikipedia
- Cell-based Architecture
- Organisation und Architektur - ein Beispiel diskutiert u.a. drei Team für einen Bounded Context.
2025-04-25 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast