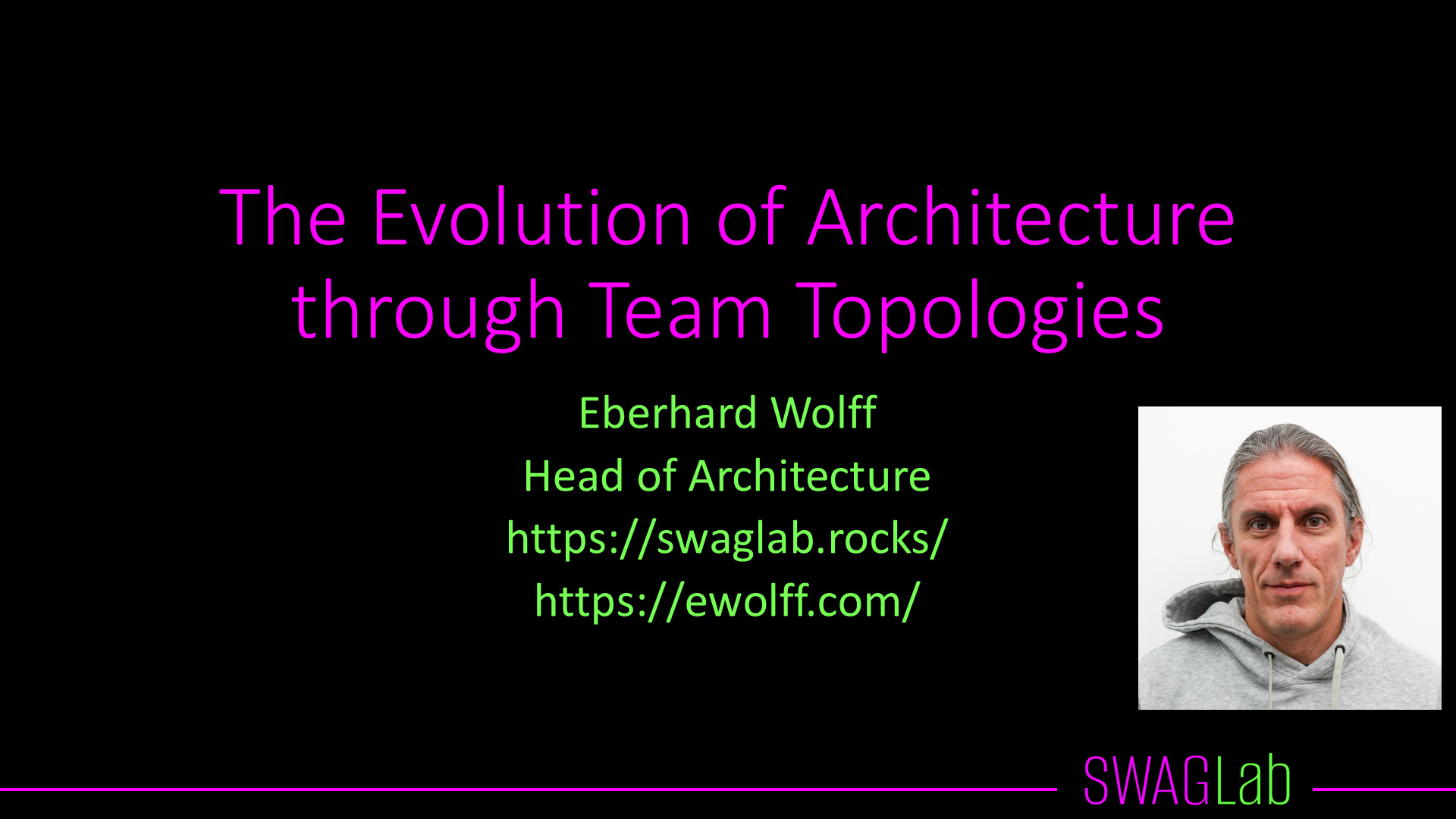Eigentlich definiert Architektur “nur” die Struktur der Software. Aber das Gesetz von Conway weißt schon auf den Zusammenhang zwischen Architektur und Organisation hin. Durch das Inverse Conway Maneuvre ist klar geworden, dass die geschickte Aufstellung der Organisation die Architektur maßgeblich beeinflussen kann. Dieser Vortrag zeigt auf, dass Team Topologie auch erhebliche Konsequenzen für die Architektur-Arbeit hat: Team Topologies fungiert nicht nur als Werkzeug für Architektur, sondern muss auch in die architektonische Planung einbezogen werden.
Links
- Folien
- D.L. Parnas: Information Distribution Aspects of Design Methodology
- Frederick P. Brooks: The Mythical Man-Month
- Episode zu Modularisierung
- Fachliche Architektur - Warum und wie?
- Episode zu Team Topologies
- Episode zur DevOps Study
- Fearless Change - Neue Ideen etablieren
- Software Architektur - Den menschlichen Faktor verbessern!
2025-05-30 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast