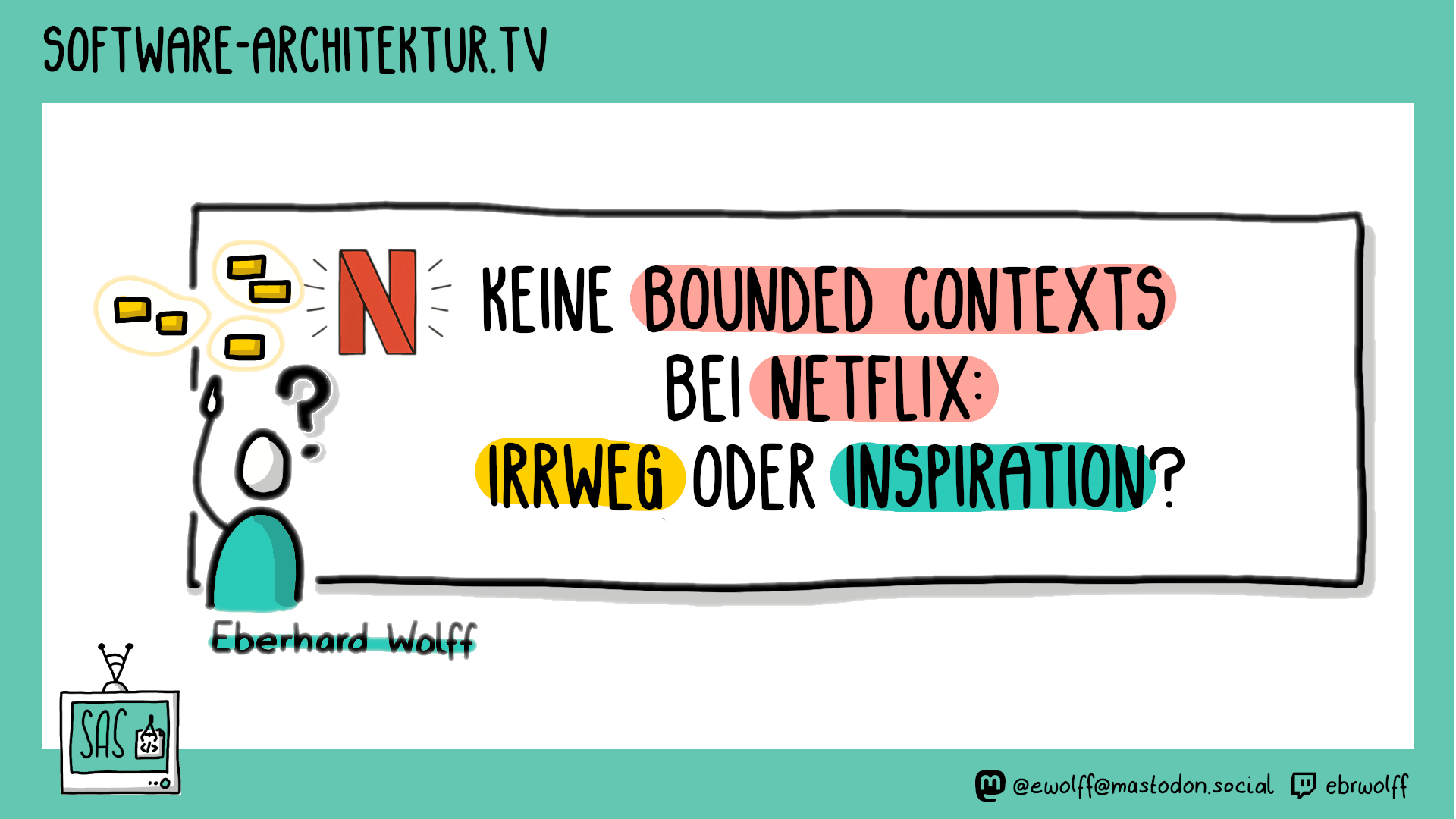In der Softwarearchitektur gilt: Systeme lassen sich besser warten und flexibler gestalten, wenn man sie in mehrere Bounded Contexts aufteilt – und das ist gerade bei Microservices-System zentral. Doch nun hat ausgerechnet Netflix, ein Pionier der Microservices-Bewegung, einen Blogpost veröffentlicht, der einen ganz anderen Weg propagiert: „Model Once, Represent Everywhere: UDA (Unified Data Architecture)“.
In dieser Episode nimmt Eberhard den Ansatz von Netflix genauer unter die Lupe und diskutiert, ob die Zeit gekommen ist, die Idee klar getrennter Bounded Contexts infrage zu stellen – und stattdessen auf ein zentrales Modell zu setzen.
Links
- Netflix Blog: Model Once, Represent Everywhere: UDA (Unified Data Architecture) at Netflix
- Modelle statt Bounded Contexts? Eine Alternative für fachliche Modularisierung
- Bounded Context - Was ist das genau?
- Stefans Tilkov: Why You Should Avoid a Canonical Data Model
- Amazon - Von Microservices zurück zu Monolithen?
2025-08-22 Thumbnail
PeerTube Video - no Big Tech!
Peertube-Video von tchncs.de eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei tchncs.de
YouTube Video
YouTube-Video eingebettet anzeigen DatenschutzerklärungVideo bei YouTube
Podcast
Hier findet sich das Audio als Podcast.MP3 Download
Infos und Feeds zum Podcast